
|
|
 Die Heraldik in
Magonien Die Heraldik in
Magonien
...oder das kleine Einmaleins
der Wappenkunde
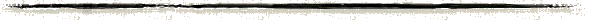
1. Grundzüge der Heraldik
2. Begriff und Gegenstand
der Heraldik
3. Ursprung und Entwicklung
der Heraldik
4. Das Wappen und seine Teile
5. Heroldsbilder
6. Figuren
7. Helm, Helmzier und Helmdecke
8. Wappenkomposition
1.
Gundzüge der Heraldik
Die folgende Abhandlung soll
sich den Grundzügen der magonischen Heraldik widmen, um die
symbolische Sprache der Wappen zu klären. Freilich kann dabei
nicht allen Einzelheiten oder landesspezifischen Sonderentwicklungen
Platz eingeräumt werden. Dennoch bleibt anzumerken, dass sich
(trotz der in anderen Gebieten teilweise großen Unterschiede)
in den Provinzen im Laufe der Zeit ganz ähnliche Regeln zur
Wappenkunde herausgebildet haben. Dies mag vermutlich mit dem überregionalen
Zusammenkommen des Adels auf Turnieren und Banketten in früheren
Zeiten zusammenhängen. Als Hochburgen der Heraldik gelten Tempturien
und Lorenien, jedoch wird auch andernorts an manchen Adelshöfen
diese Kunst und Wissenschaft gepflegt und gefördert.
2.
Begriff und Gegenstand der Heraldik
Die Heraldik ist die Lehre
von den Wappen und Zeichen, die sich damit beschäftigt, ihre
Entstehung, Geschichte, Form und Art der Darstellung zu beleuchten.
Der Begriff selbst, der seit der Zeit des tempturischen Adelskrieges
Verwendung findet, ist damit eine Art Sammelbegriff für die
Bereiche Wappenkunde, Wappenkunst und Wappenrecht, womit alle Aspekte
der Wappen abgedeckt werden. Der Begriff Heraldik selbst leitet
sich vom Aufgabenfeld der Herolde ab, welches als ,,ars heraldica",
also Kunst der Herolde bezeichnet wird. Pflicht der Herolde ist
es, bei ritterlichen Turnieren für die Einhaltung der Ordnung
zu sorgen, sowie die Turnierfähigkeit (Edelblütigkeit)
der Kämpfer zu überprüfen. Sie halten sich, insbesondere
in Kriegszeiten, in unmittelbarer Nähe ihres Herrn auf und
sind durch ihre Wappenkenntnisse, welche Freund von Feind unterscheidbar
machen, unverzichtbar. Diese Herolde schufen die Grundlagen für
ein System des Wappenwesens, indem sie erste Wappenverzeichnisse
anlegten und als Verfasser von Turnierdichtungen hervortraten, die
auch Angaben zur Herkunft und Wappen der einzelnen Ritter enthielten.
Viele dieser Wappenverzeichnisse und Dichtungen gingen beklagenswerterweise
in den Kriegswirren verloren.
3.
Ursprung
und Entwicklung der Heraldik
Wann und wo man die Anfänge
der magonischen Heraldik verorten soll, liegt im Dunkel der Geschichte.
Ob sich die Wappenkunst in Magonien unabhängig oder im Austausch
mit anderen Ländern entwickelte, darüber streiten sich
die Geister, zudem sind auch in diesem Bereich schriftliche Werke
und Kenntnisse, so sie einst existierten, oft verloren gegangen.
Ein Grund, der aber nicht von der Hand zu weisen ist und der sicherlich
mit zur Ausbildung von kennzeichnenden Symbolen führte, ist
die Tatsache der weiterentwickelten Rüstung der Ritterschaft.
Je weiter sich die Waffen- und Kriegstechnik verbesserte , desto
mehr stieg die Notwendigkeit einer schwereren Panzerung, was sich
vor allem an geschlossenen Helmen zum Schutz des Gesichtes niederschlug.
Das Mehr an Schutz war allerdings auch mit Nachteilen verbunden:
Das Sichtfeld wurde durch den schmalen Augenschlitz stark eingeschränkt,
das Atmen war durch einige Luftlöcher recht mühsam, vor
allem aber war somit das Gesicht des Ritters vollständig bedeckt,
so dass ein Erkennen unmöglich wurde. Mit dem geschlossenen
Helm wird aber auch der Zuruf während der Schlacht, gleichsam
unmöglich. Aus diesem Grund wurde neben Fahnen und Bannern
das Führen eines weiteren persönlichen Erkennungszeichens,
und zwar eines augenfälligen, für Freund und Feind zwingend
erforderlich, nämlich farbige, auffallende und unterschiedlich
gestaltete Zeichen, die (an weithin sichtbarer Stelle angebracht)
auch aus großer Entfernung ihren gewünschten Zweck erfüllen.
Als Träger des neuen Kennzeichens boten sich neben Rüstung
und Umhang auch die Pferdedecke, vor allem aber der verhältnismäßig
große Kampfschild des Ritters an. In Verbindung mit dem Schild
entwickelte sich so die ihn schmückende Schildfigur zum Wappen
des Schildträgers. Rasch wurden die Wappen auch erblich und
somit von einem persönlichen Abzeichen zu einem Symbol des
gesamten Geschlechts.
4.
Das
Wappen und seine Teile
Ein typisches Wappen besteht
aus mehreren Teilen. Neben dem freilich obligatorischen Schild sind
oft ein Helm, eine Helmdecke, eine Wulst oder eine Helmkrone und
eine Helmzier vorhanden. Sind alle Elemente vorhanden, kann man
von einem Vollwappen sprechen.. Die Schildform variiert dabei je
nach Zeit, Kampfweise und nach regional vorherrschendem Kunststil.
Die in Wappen verwendeten Farben, die sogenannten Tinkturen, beschränken
sich in der Regel auf eine relativ kleine Anzahl, nämlich Rot,
Blau, Schwarz und Grün sowie die sogenannten Metalle Silber
und Gold (die in der Darstellung mit Weiß und Gelb identisch
sind). Seltener werden noch Violett, Purpur und Fleischfarbe verwandt.
Zwei der wichtigsten Regeln besagen, dass in jedem Wappen wenigstens
einmal Gold oder Silber vorkommen muss und dass Metall stets auf
Farbe folgen soll und umgekehrt. Selbstverständlich existieren
eine Anzahl von Ausnahmen, die jedoch dann als heraldisch fehlerhaft
angesehen werden.
5.
Heroldsbilder
Heroldsbilder
entwickelten sich vermutlich aus den Schildbeschlägen
aus Metall und Leder, welche aus Holz gefertigte Schilde
gegen Schwert- oder Beilhiebe verstärken sollen.
Im Grunde sind sie geometrische Objekte und Einteilungen
im Schild, die durch ihre verschiedenen Teilungslinien
eine Wechselwirkung der Farben und Metalle erreichen.
Anzumerken ist, dass beim sogenannten Blasonieren (ein
Begriff, der aus Lorenien stammt), also bei der Beschreibung
des Wappens, die Bezeichnungen rechts und links vertauscht
sind, da man immer von der Position des Wappenträgers
ausgeht. Hier eine stattliche Anzahl von Heroldsbildern
ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
|

(für eine
größere Darstellung auf die Graphik klicken)
|
6. Figuren
Als Figuren bezeichnet man
Schildbilder, die aus der Natur übernommen wurden und die grundsätzlich
stilisiert vorkommen. Die Vorbilder stammen sowohl aus der lebendigen
als auch aus der leblosen Natur, jedoch bedient man sich auch mit
großer Phantasie der Fabelwelt. Die Stilisierung ermöglicht
auch die Darstellung exotischer Lebewesen, obschon diese im jeweiligen
Gebiet nicht vorkommen mögen Hierbei lassen sich folgende Großgruppen
unterscheiden: Himmelskörper und unbelebte Erde, Pflanzen,
Tiere, Fabelwesen, Menschen, Bauwerke, allgemeine Gegenstände
sowie Buchstaben und Zahlen (die in der Heraldik so selten wie möglich
verwendet werden sollen).
7. Helm, Helmzier und Helmdecke
Helmzieren tauchen in Magonien
nur vereinzelt als Ergänzung der Schildfigur auf und spielen
weniger im Kampf als im Turnier eine wichtige Rolle im Sinne der
prachtvollen Repräsentation des Trägers. Stoffwülste
oder Kronen am oberen Helmrand waren sicherlich zunächst angebracht,
um die Befestigung der Helmzier zu verdecken, übernahmen jedoch
bald gleichfalls eine schmückende Rolle. Helmdecken, also Tücher,
die an den Seiten und der Rückseite des Helmes herabflattern,
haben eher praktischen Ursprung und sind als Schutz
gegen Sonneneinstrahlung bzw. zur Dämpfung leichter Schwerthiebe gedacht.
Der heraldische Helm, der auf dem Schild aufsitzt, ist stets stahlfarben,
bei hohem Adel kann er auch goldfarben sein. Er hat oft Helmdecken,
die üblicherweise die Tinkturen
des Schildes wiederholen.
8. Wappenkomposition
Einen interessanten
Teilbereich der magonischen Wappenkunde bilden die Kompositionen
von Wappen oder auch Wappenverschmelzungen. Bei den
meisten Wappen war man offensichtlich darum bemüht,
Eindeutigkeit dadurch zu gewährleisten, dass man
bestenfalls Halbierungen vornahm. Da diese Form der
Komposition nur geringe Möglichkeiten bietet, entwickelte
sich bald die Quadrierung (oder Vierung) des Schildes,
so dass weitere Wappen (z.B. bei Heiraten) recht problemlos
integriert werden können. Dabei sind die Felder
1 und 4 höherwertiger, so ein Herzschild vorhanden
ist, wird hier das würdigste Wappen eingefügt.
Theoretisch lassen sich so unendlich viele Wappen kombinieren,
da bei Bedarf ein Feld einfach erneut quadriert. Als
Beispiele hierfür kann das Wappen der Provinz Tempturien
oder eine Anzahl von lorenischer Wappen dienen. Diese
Methode verbreitete sich rasch in Magonien, allerdings
führte sie im Verlauf der Geschichte insbesondere
in Lorenien zu Auswüchsen, bei denen die Forderung
nach Eindeutigkeit von Wappen oft zweifelhaft ist. Hier
ein Beispiel einer Vierung mit Herzschild. Die Nummerierung
der Felder dient zur Verdeutlichung. Feld 1 wäre
somit rechts (vom Schildträger aus gesehen, siehe
Punkt 5) oben, Feld 4 dementsprechend links unten. |
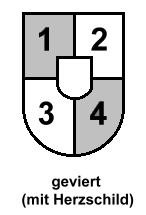
|
|